
03 Jan VORTRAG Dr. Dieter Bischop: Neue Ausgrabungen in der Bremer Altstadt
Der Vortrag beleuchtet die Ergebnisse jüngster archäologisch begleiteter Innenstadtbauprojekte, die die Bedeutung der Weser für das mittelalterliche Bremen hervorheben. Vorgestellt werden drei Grabungen: Die gerade erst im Dezember 2023 beendete Ausgrabung unter dem historischen Essighaus in der Langenstraße, die die karolingische Uferlände, aber auch bedeutende hochmittelalterliche und frühneuzeitliche Funde und Baubefunde lieferte. Unter den Weserarkaden spiegeln zahlreiche Funde Spuren des spätmittelalterlichen Hafenlebens wider. Und schließlich erbrachte die letztmögliche Ausgrabung auf dem nun vollends bebauten Teerhof Nachweise für einen Werftplatz des 14. Jahrhunderts. Handelt es sich hier sogar um den Bauplatz der 1962 entdeckten und heute im Schifffahrtsmuseum Bremerhaven präsentierten Kogge?
Der auf die Bremer Innenstadt spezialisierte Archäologe Dr. Dieter Bischop gibt Einblicke in gut 1000 Jahre Stadtgeschichte und stellt eine Auswahl an Fundstücken vor.
Der Vortrag findet in Kooperation mit der Bremer Gesellschaft für Vorgeschichte statt.
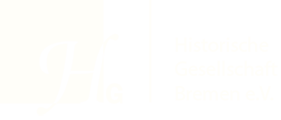
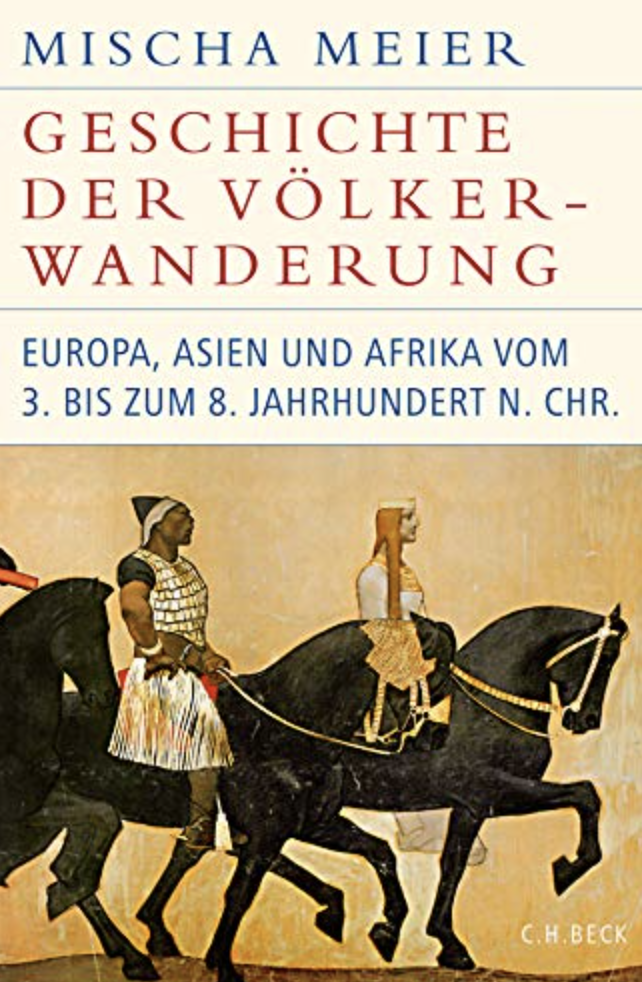


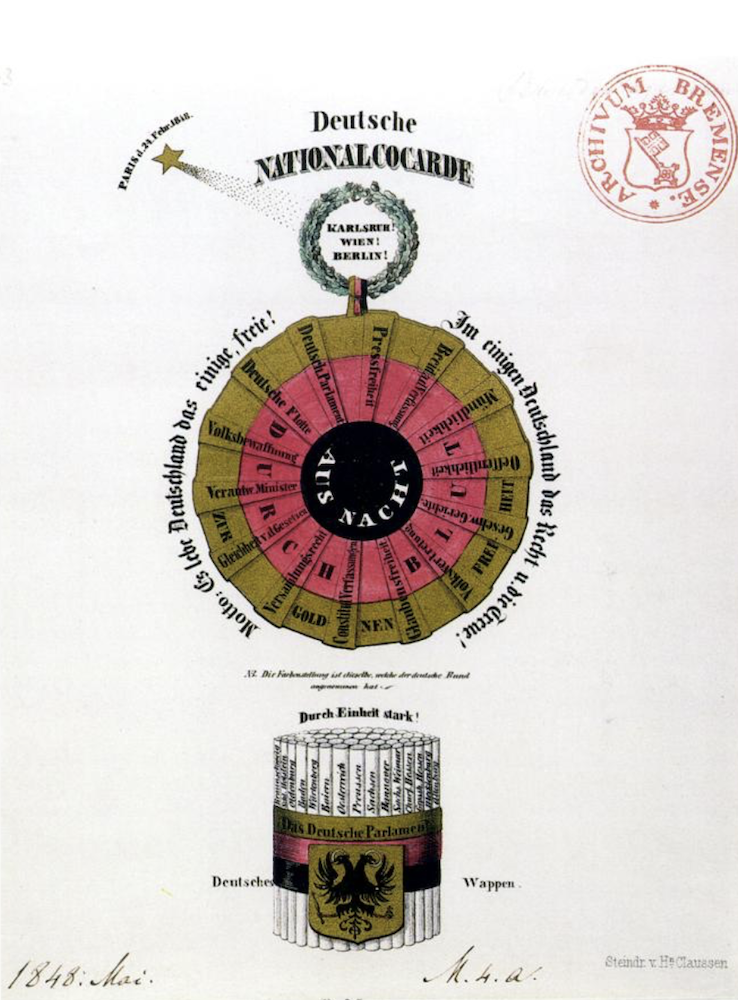
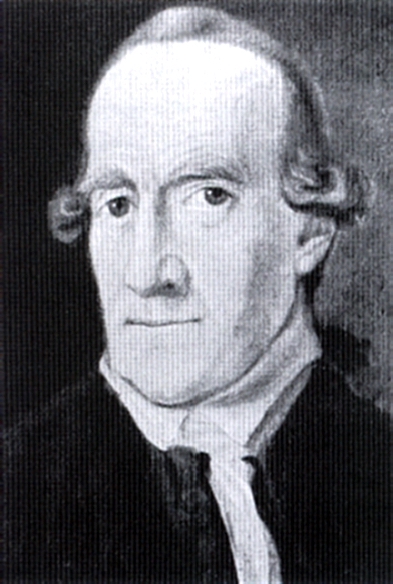
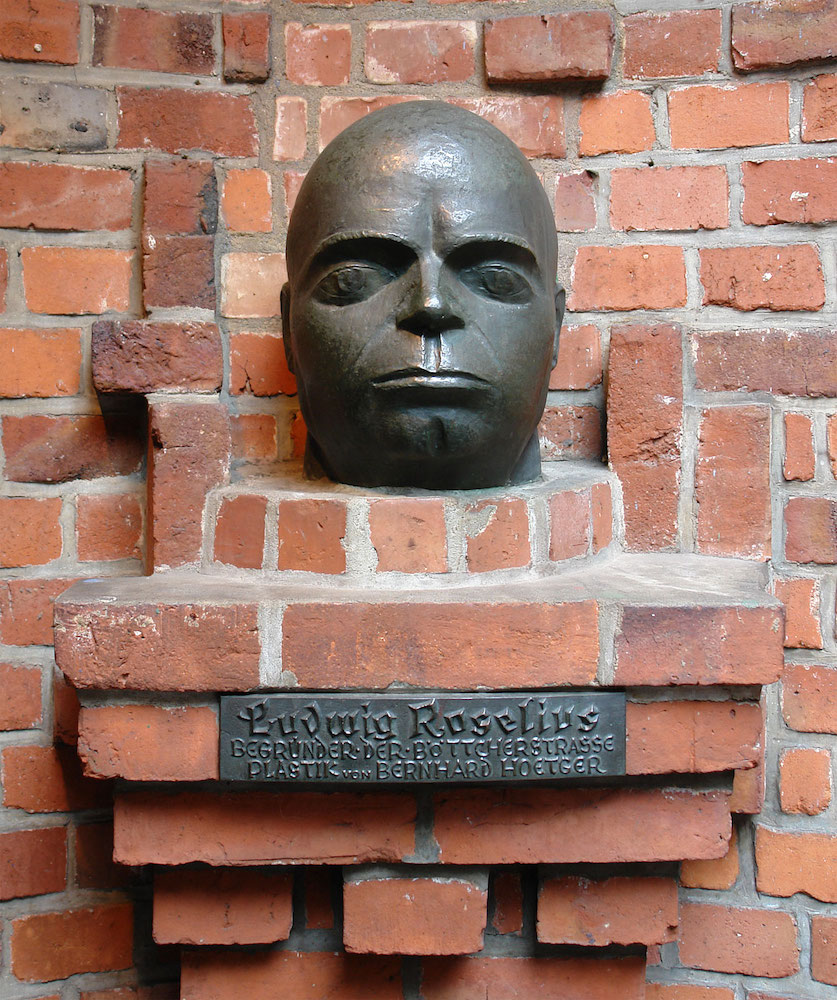

 Das unter Denkmalschutz stehende sogenannte „Alte Gerichtshaus“ an der Domsheide 16 ist das architektonisch und allegorisch auffälligste Gerichtsgebäude in Bremen. Dem Zeitgeist des Historismus geschuldet, ist die Fassade des Gebäudes reich an dekorativem Schmuck und mit zahlreichen Allegorien versehen. Doch auch innen gibt es zahlreiche Entdeckungen zu machen, die der oben zitierten Widmungstafel an der Ostertorfassade gerecht werden. Wir freuen uns, dass wir durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht, Dr. Thorsten Prange, eine kundige Führung um und durch das Gebäude erhalten.
Das unter Denkmalschutz stehende sogenannte „Alte Gerichtshaus“ an der Domsheide 16 ist das architektonisch und allegorisch auffälligste Gerichtsgebäude in Bremen. Dem Zeitgeist des Historismus geschuldet, ist die Fassade des Gebäudes reich an dekorativem Schmuck und mit zahlreichen Allegorien versehen. Doch auch innen gibt es zahlreiche Entdeckungen zu machen, die der oben zitierten Widmungstafel an der Ostertorfassade gerecht werden. Wir freuen uns, dass wir durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht, Dr. Thorsten Prange, eine kundige Führung um und durch das Gebäude erhalten.
